


Bevor einem die Luft wegbleibt
Ein Beitrag unseres Academy Leiters Uwe Schumann
In einer modernen Wohnbebauung kann auf eine Wohnraumlüftung nicht mehr verzichtet werden: Durch die immer dichter werdende Bauweise steigt die Gefahr von zu viel Feuchtigkeit in den Räumen, die Schimmel verursachen kann. Mittlerweile ist eine Wohnraumlüftung aber nicht mehr einfach nur für den Luftaustausch zuständig.
Energieeffizient bauen, heißt dicht bauen, dicht bauen bedeutet den Leckageluftwechsel zu unterbinden. Gleichzeitig ist eine gute Luftqualität eine wesentliche Voraussetzung für die Bewohnbarkeit. Da wäre zwar ein mechanisch erzeugter Luftwechsel die passende Lösung, doch noch längst nicht haben Wohnraumlüftungen den Markt in Deutschland vollkommen durchdrungen. Sind unzählige Normen und hochkomplexe und teilweise sich widersprechende Gesetzesregelungen schuld? Liegt die Herausforderung in mangelnder Kenntnis, was die Notwendigkeit und die Effizienzbewertung einer Wohnraumlüftung anbelangt? Oder haben Politik, Branche, Wohnungswirtschaft und Nutzer jahrelang aneinander vorbei agiert? Wohnraumlüftungen gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Systemvarianten und Dimensionierungen. Trotz des breiten Angebots an Lösungen haben sich Wohnraumlüftungen längst nicht flächendeckend durchgesetzt. Es wird also höchste Zeit, ein paar Denkanstöße zu geben.
Handlungsgrundlage Energieeinsparverordnung
Werfen wir zuerst einen Blick auf die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Handlungsgrundlage ist die Energieeinsparverordnung (EnEV). Große Veränderungen sind für 2015 aufgrund der im vergangenen Jahr novellierten Fassung nicht zu erwarten, die geforderten politischen Ziele werden erst mit Anfang 2016 umgesetzt. Einer der EnEV-Knackpunkte: Der zulässige Höchstwert des Primärenergiebedarfs sinkt um 25 %. Die geforderte Unterschreitung kann wirtschaftlich allein über die Verbesserung der Gebäudehülle nicht mehr erreicht werden, d.h. die Anlagentechnik wird zur spielentscheidenden Größe. Der Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da der Lüftungswärmeverlust eines Gebäudes mittlerweile nahezu 50 % ausmacht und die Absenkung des Primärenergiefaktors für Strom den rechnerischen Effizienzgrad dieser Technologie weiter steigert.
Tschüss, Primärenergiebedarf. Hallo, CO2-Bewertung!
Wenn es nach der Meinung vieler Experten geht, sollte die EnEV aber bald ohnehin Geschichte sein. So sprechen sich vier Mitarbeiter des Instituts für energieoptimierte Systeme (EOS) in einem Beitrag für eine Verknüpfung aus: Sie fordern die Zusammenlegung der EnEV und des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG), um überschneidende Bestimmungen zu vermeiden, die zusätzlich noch mit gültigem Landesrecht oder Sonderregelungen aus Fördermaßnahmen abgeglichen werden müssen. Ein weiterer Ansatz ist: weg mit der Orientierung am Primärenergieverbrauch und hin zur CO2-Bewertung. Durch den Fokus auf den Primärenergiefaktor bleiben viele CO2-Einsparpotenziale ungenutzt, die maßgeblich für die Erreichung der Klimaschutzziele Deutschlands sind. Die Folge: Auf dem Papier werden viele Gebäude energetisch besser dargestellt, als sie es eigentlich sind, so die Autoren. So bleiben die Klimaschutzziele 2020 in weiter Ferne und die Werte vieler Liegenschaften sind mitunter Mogelpackungen.
CO2-Gebäudesanierungsprogramm wird um 200 Mio. Euro aufgestockt
Das Bundeskabinett hat noch im Dezember vergangenen Jahres mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) und dem Aktionsprogramm 2020 weiterführende energiepolitische Beschlüsse gefasst. Diese werden die Sanierungstätigkeit deutlich beleben. Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, ist der Meinung: „Handlungsbedarf gibt es vor allem bei der Energieeffizienz und beim Klimaschutz. Hier setzen wir mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz an und machen damit die Energieeffizienz zur zweiten Säule der Energiewende.“ Die wichtigsten Elemente des NAPE sind der Vorschlag zur Einführung einer steuerlichen Förderung von energetischen Gebäudesanierungen für private Haus- und Wohnungseigentümer, die Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms und wettbewerbliche Ausschreibungen für Energiesparprojekte mit einem angestrebten Fördervolumen im dreistelligen Millionenbereich pro Jahr. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW wird um 200 Mio. € auf insgesamt 2 Mrd. € pro Jahr aufgestockt. Noch ist aber nicht alles in trockenen Tüchern: Zur Umsetzung der steuerlichen Förderung von Effizienzmaßnahmen im Gebäudesektor sind Gespräche zwischen Bundesregierung und Ländern vorgesehen. Spätestens Ende Februar sollte eine finale Entscheidung getroffen werden. Doch die Gespräche wurden kurzfristig ausgesetzt.
Wohnraumlüftung mit Etikett: Das Labelling kommt 2016
Was ganz sicher nächstes Jahr kommen wird, ist mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Markt für Wohnraumlüftungsgeräte. Ab Januar 2016 kommt das Thema Labelling auch bei der Wohnraumlüftung an: Wie beim Kühlschrank wird die Energieeffizienz dann mit den Buchstaben A bis G bewertet, es gibt Angaben zur Lautstärke des Lüftungsgeräts und dem maximalen Luftvolumenstrom. Diese Einteilung berücksichtigt unter anderem die Faktoren Wärmerückgewinnung, Ventilatoreffizienz, Regelung und Frostschutzschaltung. Im Gesamtkontext gesehen kann das Label aber nur die Werte der Wohnraumlüftung abbilden. Aussagen zur gesamten Anlagentechnik würde dann ein sogenanntes Packagelabel treffen.
Höher, schneller, weiter? Anstoß zur Diskussion
Aber vielleicht ist es im Zuge dessen an der Zeit, ganz grundlegend über die Entwicklung neuer Ansätze bei Wohnraumlüftungsanlagen nachzudenken. Kritisch hinterfragt: Ist höher, schneller, weiter immer das Richtige? Müssen es immer 90% und mehr Wärmerückgewinnung sein oder wären auch 70% ausreichend? Zum Hintergrund: Moderne Wohnraumlüftungsgeräte mit hohen Wärmerückgewinnungsgraden ziehen fast alle Energie aus der Abluft, sodass die Fortluft extrem kalt ist. Um eine Gerätevereisung zu verhindern, bedarf es immer komplexerer Frostschutzstrategien mit deutlich höherem Regelaufwand. Teilweise werden Vorheizregister mit einbezogen, die den Hilfsenergiebedarf wieder erhöhen – ein Teufelskreis? Aber ist dieser Weg der richtige? Weniger Aufwand mit weniger Technik bedeutet auch weniger Kosten. Durch die gesunkene finanzielle Hürde könnten Wohnraumlüftungen nicht mehr als verzichtbare Ausstattung gelten, sondern als das, was sie tatsächlich sind: notwendige Haustechnik für jedes Wohngebäude.
Feuchteschutz versus Luftqualität?
Eine Glaubensfrage ist das Thema Feuchteschutz oder Luftqualität. Der Unterschied liegt in der zugeführten Luftmenge: Zum Feuchteschutz und der Abwehr von Schimmel wird eine geringere Menge Luft ausgetauscht – ein hoher Wärmerückgewinnungsgrad spielt hier technisch gesehen keine Rolle. Dies könnte mit kleinen kompakten Lüftungsgeräten und einem minimalistischen Verteilnetz umgesetzt werden. Möchte man eine der Außenluft vergleichbare Luftqualität in der Wohnung haben, muss eine größere Luftmenge zu- bzw. abgeführt werden. Das bedeutet letztlich mehr Geräteleistung, mehr Verteilaufwand und mehr Platzbedarf; außerdem steigt im Winter die Gefahr von zu trockener Luft. Eine Lösung liegt in der bedarfsgesteuerten Lüftung: Gerade in Räumen, in denen man sich über mehrere Stunden aufhält, wie im Schlafzimmer, ist eine gute Luftqualität besonders wichtig. Bei Nutzräumen wie Küche oder Bad ist es hingegen entscheidend, dass die Luftfeuchtigkeit zuverlässig abgeführt wird. Eine solche Art der Wohnraumlüftung verlangt nach Luftqualitäts- und Feuchte-Sensoren und einer intelligenten Regelung. Vielleicht liegen künftige Lösungen bei Systemen, die keine Nennlüftung anbieten, sondern „lediglich“ die reduzierte Lüftung. Verbunden mit morgen- und abendlichem Fensterlüften deckt diese das Hauptziel Feuchteschutz zusammen mit einer guten Luftqualität zuverlässig ab.
Fazit
Die Frage, wohin sich der Wohnraumlüftungsmarkt entwickelt, ist von vielen Faktoren abhängig. Auf der einen Seite beeinflussen Normen und die Gesetzgebung Entwicklungen. Auf der anderen Seite bestimmen Nachfrage und Kundenwunsch, wohin die Reise geht. Die individuelle Abstimmung des Systems auf die konkreten Anforderungen des Nutzers ist dabei unumgänglich. Moderne Kunden legen Wert auf höchste Variabilität und Flexibilität bei der Wahl der richtigen Wohnraumlüftung.
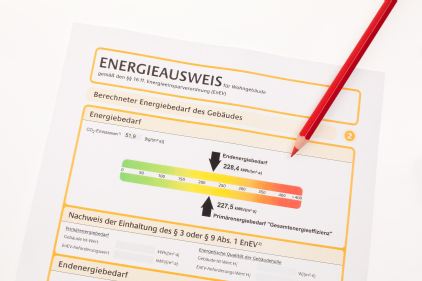


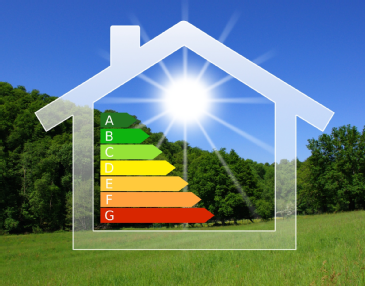
Comments
Kommentar schreiben